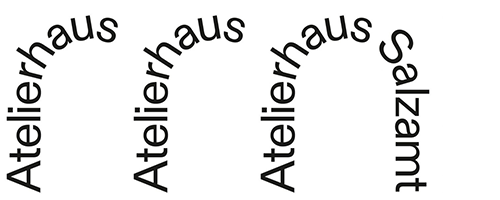Éléa-Jeanne Schmitter – Artist in Residence
November – December 2025
*Für die deutsche Version bitte scrollen.
Éléa-Jeanne Schmitter was invited to Linz as part of a collaboration between the Atelierhaus Salzamt, the Cité internationale des arts in Paris, the Austrian Cultural Forum in Paris and the Institut Français d’Autriche.
Before her stay at the Salzamt studio house, we asked Éléa-Jeanne Schmitter a few questions about her work.
How do you work? Please select 2–3 characteristic works and provide a picture and description of each one.
My work begins with archives, whether personal, domestic, institutional, or statistical. I do not treat them as fixed evidence but as unstable and porous materials where silence, absence, and disappearance are just as meaningful as presence. Each project defines its own form: sometimes photographic, sometimes sculptural, textual, or collaborative. I see each project as an autonomous entity that evolves once initiated, shaped by those who interact with it. I am particularly interested in thresholds, moments of suspension where meaning is not yet stabilized, or where memory has already fractured. These spaces of tension reveal both political and emotional depth, and they allow new ways of transmitting and reimagining histories to emerge.

40 Years 70kg addresses the structural invisibility of women in medical and industrial research. Inspired by Caroline Criado Perez’s Invisible Women, the work reflects on how the male body of “40 years old, 70kg” has long been considered the universal norm in crash-test dummies and clinical trials. Through visual translation of statistical gaps, it reveals how women’s bodies are excluded from safety protocols, with consequences for health and survival.

SO PRETTY revisits family archives in which photographs of tables carefully prepared for celebration reveal a persistent absence: the chairs remain empty. Captured on the eve of gatherings that never took place, these images shift from being simple memories to announcing the silence and isolation that followed, particularly linked to maternal depression. The work questions how archives can testify not only to what was, but also to what never happened.

What Remains is a recent project that questions what humanity chooses to transmit about itself. Taking as a starting point the NASA Pioneer plaques of the 1970s meant to represent humanity to potential extraterrestrial life but built on Western, binary, and gendered norms. The work proposes a collective and critical re-reading of transmission today. A new version of the plaque integrates forms drawn from the body, intimacy, and digital languages. By inviting participants to add what they wish to transmit, the work becomes a shifting and shared space, where transmission is understood as a conscious act of choice, rupture, or transformation.
Do you have a particular project in mind that you would like to work on in Linz?
Yes, I would love to continue working on the project “Les Coussins” but also I would like to develop ANAK, a project that originates in my family history. Anak was my ancestor, a circus artist and a “giant” from the Vosges region in France. His life moved between spectacle and marginality, and he even maintained a correspondence with a London-based woman who was also a giant, although they never met in person. For me, his story embodies the fragile line between transmission and silence: what is remembered, what is mythologized, and what is lost.
In Linz, I would like to situate this intimate history within a broader cultural and legendary landscape. The Vosges, like the Alps of Upper Austria, are filled with stories of giants, spirits, and extraordinary beings tied to the mountains. These legends echo one another across borders: in France, the giant Anak becomes a family myth; in Austria, mountains such as the Glungezer are home to giants in local tales. By bringing these narratives into dialogue, I want to explore how landscapes carry both memory and imagination, how they transmit legends that shape our sense of belonging.
The project will combine photographic interventions, archival re-enactments, and possibly the collection of local oral histories. By weaving together my family archive with the mythological resonances of Upper Austria, I hope to create a new, shared mythology that connects personal narrative to collective memory. In this way, ANAK becomes not only a story of one man but also a reflection on how landscapes preserve and transmit legends of bodies deemed extraordinary, excessive, or marginal.
Your project, ‘Les Coussins’, began in Milan and will continue in Budapest / Linz. What inspired you to research this topic? Did you make any observations within the scope of your project in France, where you are from?
38% began with a statistic that deeply affected me: during the 2014 World Cup, researchers in the UK recorded a 38% rise in domestic violence following football matches. I was struck by how this number, while shocking, only represented reported cases, leaving much hidden. I wanted to translate this abstraction into something visual and material, to give form to the violence statistics tend to flatten.
In the project, I perforate photographic prints according to this percentage, literally damaging the surface of the image. The work is not about showing violence directly but about inscribing its impact into the material of the photograph. The outstanding number of perforations I have to make and the wide range of errors occurring also question the real value of those numbers and how they are mainly disconnected to reality as they (in this case) only refer to the persons who called the police to signal this violence.
In France, as in many countries, I observed the same dynamics. Domestic violence is systemic, often silenced, and amplified by collective events like football. 38% reflects not only a local reality but a global one, questioning how numbers can reveal collective wounds.
In your other photography projects, you amplify the voices of women in society. How do you think photography can remain compelling in an age of social media image overload and the rise of AI? Tell us about your unique photographic techniques.
I use photography as a slow, fragile, and unstable medium. Instead of producing more images, I often erode them, perforate them, or combine them with archives and objects. This creates a tension where the photograph is not only a representation but also a material body, marked by absence and transformation.
I also integrate collaboration into my process. Many of my works are created with women and marginalized groups who control their own image, their own archive, or their own narrative. This is important in a time when AI and algorithms often reproduce stereotypes or erase complexity. By working collectively, I let the project evolve as an autonomous entity, where meaning is shared rather than imposed by an artist of an institution.
This blog article will be supplemented after Éléa-Jeanne Schmitter’s stay with a report on her work at the Atelierhaus Salzamt.
Instagram: @eleajeanne
www.eleajeanneschmitter.com
***
Éléa-Jeanne Schmitter wurde im Rahmen einer Kooperation mit der Cité internationale des arts in Paris, dem Österreichischen Kulturforum Paris und dem Institut Français d’Autriche nach Linz eingeladen.
Vor ihrem Aufenthalt im Atelierhaus Salzamt haben wir Éléa-Jeanne Schmitter einige Fragen zu ihrer Arbeit gestellt.
Wie arbeitest du? Bitte wähle zwei bis drei charakteristische Arbeiten aus und stelle jeweils ein Bild und eine Beschreibung zur Verfügung.
Meine Arbeit beginnt mit Archiven, seien es persönliche, häusliche, institutionelle oder statistische. Ich betrachte sie nicht als feststehende Beweise, sondern als instabile und poröse Materialien, in denen Stille, Abwesenheit und Verschwinden ebenso bedeutungsvoll sind wie Präsenz. Jedes Projekt definiert seine eigene Form: manchmal fotografisch, manchmal skulptural, textuell oder kollaborativ. Ich betrachte jedes Projekt als eigenständige Einheit, die sich nach ihrer Initiierung weiterentwickelt und von denjenigen geprägt wird, die mit ihr interagieren. Ich interessiere mich besonders für Schwellen, Momente der Schwebe, in denen die Bedeutung noch nicht stabilisiert ist oder in denen die Erinnerung bereits zerbrochen ist. Diese Spannungsfelder offenbaren sowohl politische als auch emotionale Tiefe und ermöglichen neue Wege der Vermittlung und Neukonzeption von Geschichte.
40 Years 70kg befasst sich mit der strukturellen Unsichtbarkeit von Frauen in der medizinischen und industriellen Forschung. Inspiriert von Caroline Criado Perez’ Invisible Women reflektiert die Arbeit darüber, wie der männliche Körper von „40 Jahren, 70 kg” lange Zeit als universelle Norm in Crashtest-Dummys und klinischen Studien galt. Durch die visuelle Übersetzung statistischer Lücken zeigt sie, wie Frauenkörper aus Sicherheitsprotokollen ausgeschlossen werden, mit Folgen für Gesundheit und Überleben.
SO PRETTY greift auf Familienarchive zurück, in denen Fotos von sorgfältig für Feierlichkeiten gedeckten Tischen eine beständige Leere offenbaren: Die Stühle bleiben leer. Diese Bilder, die am Vorabend von Zusammenkünften aufgenommen wurden, die nie stattfanden, wandeln sich von einfachen Erinnerungen zu Zeugnissen der Stille und Isolation, die darauf folgten und insbesondere mit mütterlicher Depression in Verbindung stehen. Die Arbeit hinterfragt, wie Archive nicht nur Zeugnis davon ablegen können, was war, sondern auch davon, was nie geschehen ist.
What Remains ist ein aktuelles Projekt, das hinterfragt, was die Menschheit über sich selbst weitergeben möchte. Ausgangspunkt sind die NASA-Pioneer-Plaketten aus den 1970er Jahren, die die Menschheit gegenüber potenziellen außerirdischen Lebensformen repräsentieren sollten, aber auf westlichen, binären und geschlechtsspezifischen Normen basieren. Die Arbeit schlägt eine kollektive und kritische Neuinterpretation der heutigen Weitergabe vor. Eine neue Version der Plakette integriert Formen, die aus dem Körper, der Intimität und digitalen Sprachen stammen. Indem die Teilnehmer eingeladen werden, hinzuzufügen, was sie weitergeben möchten, wird die Arbeit zu einem sich wandelnden und gemeinsamen Raum, in dem Weitergabe als bewusster Akt der Wahl, des Bruchs oder der Transformation verstanden wird.
Hast du ein bestimmtes Projekt im Sinn, an dem du in Linz arbeiten möchtest?
Ja, ich würde sehr gerne weiter am Projekt „Les Coussins“ arbeiten, aber ich möchte auch ANAK entwickeln, ein Projekt, das seinen Ursprung in meiner Familiengeschichte hat. Anak war mein Vorfahr, ein Zirkuskünstler und „Riese“ aus der Region Vogesen in Frankreich. Sein Leben bewegte sich zwischen Spektakel und Marginalität, und er unterhielt sogar einen Briefwechsel mit einer ebenfalls riesengewachsenen Frau aus London, obwohl sie sich nie persönlich begegnet sind. Für mich verkörpert seine Geschichte die fragile Grenze zwischen Weitergabe und Schweigen: Was bleibt in Erinnerung, was wird mythologisiert und was geht verloren?
In Linz möchte ich diese intime Geschichte in einen breiteren kulturellen und legendären Kontext stellen. Die Vogesen sind, wie die Alpen Oberösterreichs, voller Geschichten über Riesen, Geister und außergewöhnliche Wesen, die mit den Bergen verbunden sind. Diese Legenden finden grenzüberschreitend Widerhall: In Frankreich wird der Riese Anak zu einem Familienmythos, in Österreich sind Berge wie der Glungezer in lokalen Erzählungen die Heimat von Riesen. Indem ich diese Erzählungen in einen Dialog bringe, möchte ich untersuchen, wie Landschaften sowohl Erinnerung als auch Vorstellungskraft transportieren, wie sie Legenden weitergeben, die unser Zugehörigkeitsgefühl prägen.
Das Projekt wird fotografische Interventionen, archivarische Nachstellungen und möglicherweise die Sammlung lokaler mündlicher Überlieferungen kombinieren. Indem ich mein Familienarchiv mit den mythologischen Anklängen Oberösterreichs verknüpfe, hoffe ich, eine neue, gemeinsame Mythologie zu schaffen, die persönliche Erzählungen mit kollektivem Gedächtnis verbindet. Auf diese Weise wird ANAK nicht nur zur Geschichte eines einzelnen Mannes, sondern auch zu einer Reflexion darüber, wie Landschaften Legenden von Körpern bewahren und weitergeben, die als außergewöhnlich, exzessiv oder marginal gelten.
Dein Projekt „Les Coussins” begann in Mailand und wird in Budapest/Linz fortgesetzt. Was hat dich zu diesem Thema inspiriert? Hast du im Rahmen deines Projekts in Frankreich, wo du herkommst, Beobachtungen gemacht?
38 % begann mit einer Statistik, die mich tief bewegt hat: Während der Weltmeisterschaft 2014 verzeichneten Forscher im Vereinigten Königreich einen Anstieg der häuslichen Gewalt um 38 % nach Fußballspielen. Mich hat beeindruckt, dass diese Zahl zwar schockierend ist, aber nur die gemeldeten Fälle widerspiegelt und vieles im Verborgenen bleibt. Ich wollte diese Abstraktion in etwas Visuelles und Materielles übersetzen, um der Gewalt, die in Statistiken oft verflacht wird, eine Form zu geben.
In diesem Projekt perforiere ich Fotodrucke entsprechend diesem Prozentsatz und beschädige damit buchstäblich die Oberfläche des Bildes. Bei dieser Arbeit geht es nicht darum, Gewalt direkt zu zeigen, sondern ihre Auswirkungen in das Material der Fotografie einzuschreiben. Die enorme Anzahl der Perforationen, die ich ausführen muss, und die Vielzahl der dabei auftretenden Fehler stellen auch den tatsächlichen Wert dieser Zahlen in Frage und zeigen, wie wenig sie mit der Realität zu tun haben, da sie (in diesem Fall) sich nur auf die Personen beziehen, die die Polizei gerufen haben, um diese Gewalt zu melden.
In Frankreich habe ich, wie in vielen anderen Ländern auch, die gleiche Dynamik beobachtet. Häusliche Gewalt ist systemisch, wird oft verschwiegen und durch kollektive Ereignisse wie Fußball noch verstärkt. 38 % spiegeln nicht nur eine lokale, sondern eine globale Realität wider und werfen die Frage auf, wie Zahlen kollektive Wunden offenbaren können.
In deinen anderen Fotoprojekten verstärkst du die Stimmen von Frauen in der Gesellschaft. Wie kann die Fotografie deiner Meinung nach in Zeiten der Bildüberflutung durch soziale Medien und des Aufstiegs der KI weiterhin überzeugend sein? Erzähle uns von deinen einzigartigen fotografischen Techniken.
Ich nutze die Fotografie als langsames, fragiles und instabiles Medium. Anstatt mehr Bilder zu produzieren, zerfalle ich sie oft, perforiere sie oder kombiniere sie mit Archiven und Objekten. Dadurch entsteht eine Spannung, in der das Foto nicht nur eine Darstellung, sondern auch ein materieller Körper ist, geprägt von Abwesenheit und Transformation.
Ich integriere auch Zusammenarbeit in meinen Prozess. Viele meiner Arbeiten entstehen in Zusammenarbeit mit Frauen und marginalisierten Gruppen, die ihre eigenen Bilder, ihre eigenen Archive oder ihre eigenen Narrative kontrollieren. Dies ist wichtig in einer Zeit, in der KI und Algorithmen oft Stereotypen reproduzieren oder Komplexität ausblenden. Durch die kollektive Arbeit lasse ich das Projekt sich als autonome Einheit entwickeln, in der Bedeutung geteilt wird, anstatt von einem Künstler oder einer Institution aufgezwungen zu werden.
Dieser Blogartikel wird nach Éléa-Jeanne Schmitters Aufenthalt mit einem Bericht über ihre Arbeit im Atelierhaus Salzamt ergänzt.
Instagram: @eleajeanne
www.eleajeanneschmitter.com